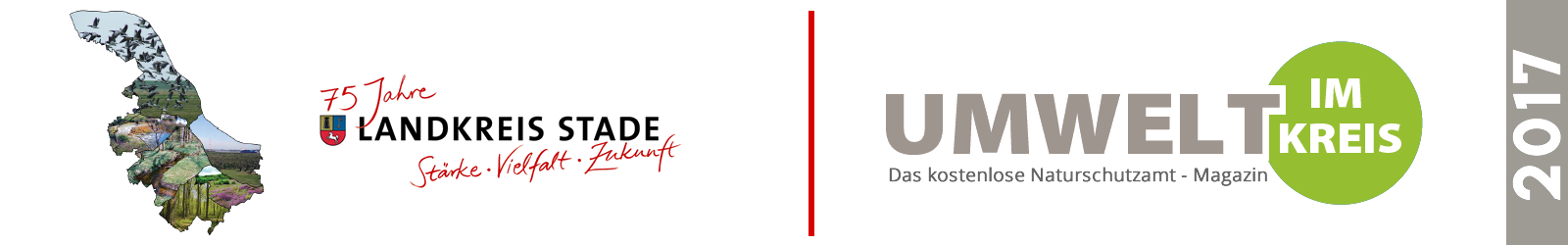

Autor
Dr. Karsten Klopp
Leiter ESTEBURG
Projekt-Steckbrief
Förderschwerpunkt: Sichern von Ökosystemleistungen
Bundesland: bundesweit
Laufzeit: Juli 2016–Juni 2022
Gesamt-Finanzvolumen: 4,9 Mio €
Koordinierender Projektpartner: Universität Hohenheim, Institut für Landschaftsökologie und Vegetationskunde
Verbundpartner: Universität Bonn, Landesverband Sächsisches Obst, Obstbauversuchsring des Alten Landes e. V., Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs- und Beratungsring e. V., Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee
Fördergeber: Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie das Ministerium fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien Hansestadt Hamburg, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW (LANUV) mit Mitteln des Ministeriumsfür Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
Prof. Dr. Martin Dieterich
Universität Hohenheim, Institut für Landschaftsökologie und
Vegetationskunde (320 a)
August von Hartmann-Straße 3
70599 Stuttgart
Telefon: 07114 5923-530
martin.dieterich@uni-hohenheim.de
Ansprechpartner Region Altes Land/ Niederelbe
ESTEBURG Obstbauzentrum Jork
Moorende 53
21635 Jork
Integrierter Obstbau:
Obstbauversuchsring
des Alten Landes e. V.
Dr. Wolfram Klein
wolfram.klein@esteburg.de
Ökologischer Obstbau: Öko-Obstbau
Norddeutschland V&B-Ring e. V.
Bastian Benduhn
Bastian.benduhn@lwk-niedersachsen.de
Biologische Vielfalt im Obstbau
Das Alte Land und die Niederelbe nehmen am Verbundprojekt des Bundesamtes für Naturschutz teil
Im Juli letzten Jahres startete ein Bundesprojekt, das die Situationserfassung und Förderung der Artenvielfalt im Obstbau des Alten Landes zum Ziel hat. Auf Initiative der bundesdeutschen Vertretungen für den integrierten und ökologischen Obstbau, der Bundesfachgruppe Obst und der Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau, wurde das bundesweit angelegte Verbundprojekt entwickelt und beantragt. Für den norddeutschen Standort ist das Alte Land durch seinen Anteil von 30 % an der deutschen Apfelproduktion prädestinierter Partner. Im Landkreis Stade betrifft das Projekt etwa 650 Obstbaubetriebe mit einer Fläche von ca. 8.000 ha Erwerbsobstbau.
Zum Verbundprojekt
Erprobungsphase
Ziel ist es, die Artenvielfalt im Obstbau zu steigern und das Bewusstsein für dieses Agrarökosystem zu fördern. Das Projekt kann dabei auf die Ergebnisse früherer Vorhaben zurückgreifen, die Einzelthemen zu mehr Biodiversität im Obstbau behandelt haben. Es gibt drei Teilbereiche, für die jeweils moderne Managementverfahren entwickelt wurden, um die Biodiversität in den Projektregionen zu steigern: den integrierten Erwerbsobstbau, den ökologischen Erwerbsobstbau sowie Streuobst- Junganlagen. Im norddeutschen Projektgebiet werden aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung die Teilbereiche integrierter und ökologischer Erwerbsobstbau bearbeitet. Die Maßnahmen werden zunächst in Pilotbetrieben erprobt und von hier aus im Schneeballsystem weiterverbreitet. Sie umfassen u.a. die Begrünung der Fahrgasse, das Pflanzen von Kleinsträuchern sowie das Anbringen von Nisthilfen. Erfolgreich erprobte Methoden sollen langfristig sowohl in die Ausbildung angehender Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter als auch in die Anbaurichtlinien von ökologischem und integriertem Obstbau einfließen.
Engagement für mehr Vielfalt
Der Wunsch, sich für die Biodiversität zu engagieren, entstand im Obstbau selbst. Die Obstbäuerinnen und Obstbauern haben die Maßnahmen gemeinsam mit Anbau- und Naturschutzexpertinnen und -experten entwickelt; sie agieren als Botschafter für den Naturschutz. Die Teilprojekte werden in den großen Obstbauregionen Deutschlands wie dem Bodenseeraum, Südbaden, Rheinland-Pfalz und der Niederelbe mit dem Schwerpunkt Altes Land durchgeführt. Damit wird eine hohe Flächenwirkung aus dem Projekt heraus gewährleistet. Die Kulturlandschaften sind teilweise stark durch den Obstbau geprägt; sie unterscheiden sich u. a. in den Obstsorten, der Bewirtschaftungsart, der Anlagengröße und den natürlichen Voraussetzungen. Der Zustand der biologischen Vielfalt der jeweiligen Region wird anhand folgender Kriterien ermittelt: Artenvielfalt, Nützlings-/Schädlingssystem, Qualität der Nahrungsmittelproduktion, schonender Einsatz von Produktionsmitteln, Bodenfruchtbarkeit, Wasserhaushalt, Landschaftsbild und Erholungsfunktion. Über die weiteren Ergebnisse im Projekt und in der Entwicklung der im Landkreis Stade liegenden Obstbauflächen wird in den kommenden Ausgaben der Umwelt im Kreis berichtet werden.
Selbst größere Säugetiere sind in Obstanlagen nicht ungewöhnlich (Foto: Dr. W. Klein)
Blühende Kirschbäume und Fahrgassen bieten vielen Insekten Nahrung (Foto: M. Elsen)
Artenvielfalt im Obstbau: Wespenspinne (Foto: Dr. W. Klein)
Artenvielfalt im Obstbau: Weibchen einer Plattbauchlibelle (Foto: Dr. W. Klein)
Turmfalken sind als „Mäusejäger“ im Obstbau gerne gesehen (Foto: G.-M. Heinze)

Autor
Dr. Karsten Klopp
Leiter ESTEBURG
Prof. Dr. Martin Dieterich
Universität Hohenheim, Institut für Landschaftsökologie und
Vegetationskunde (320 a)
August von Hartmann-Straße 3
70599 Stuttgart
Telefon: 07114 5923-530
martin.dieterich@uni-hohenheim.de
Ansprechpartner Region Altes Land/ Niederelbe
ESTEBURG Obstbauzentrum Jork
Moorende 53
21635 Jork
Integrierter Obstbau:
Obstbauversuchsring
des Alten Landes e. V.
Dr. Wolfram Klein
wolfram.klein@esteburg.de
Ökologischer Obstbau: Öko-Obstbau
Norddeutschland V&B-Ring e. V.
Bastian Benduhn
Bastian.benduhn@lwk-niedersachsen.de
Projekt-Steckbrief
Förderschwerpunkt: Sichern von Ökosystemleistungen
Bundesland: bundesweit
Laufzeit: Juli 2016–Juni 2022
Gesamt-Finanzvolumen: 4,9 Mio €
Koordinierender Projektpartner: Universität Hohenheim, Institut für Landschaftsökologie und Vegetationskunde
Verbundpartner: Universität Bonn, Landesverband Sächsisches Obst, Obstbauversuchsring des Alten Landes e. V., Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs- und Beratungsring e. V., Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee
Fördergeber: Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sowie das Ministerium fürLändlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg, das Ministerium für Umwelt,Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und ForstenRheinland-Pfalz, die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien Hansestadt Hamburg,das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutzdes Landes NRW (LANUV) mit Mitteln des Ministeriumsfür Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft




