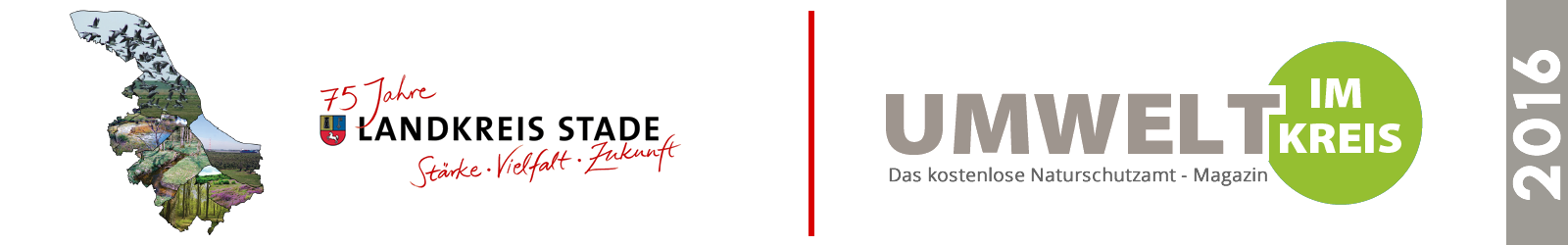

Der Autor
Daniel Nösler
Kreisarchäologe des
Landkreises Stade.
Vom 28. April bis 28. August 2017 wird im Museum Altes Land eine Ausstellung zum Thema „Bracks als Natur- und Kulturdenkmale“ zu sehen sein. Darin wird die Geschichte, Verbreitung und heutige Bedeutung der Kolke in den drei „Meilen“ des Alten Landes gezeigt. Das Buch von Hans Peter Siemens wird in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung zu dem Termin neu erscheinen.
BRACKS – wertvolle Natur- und Kulturdenkmale
Entstanden durch Naturgewalt bilden die tiefen Kleingewässer hinter dem Deich kulturhistorische Zeugnisse und ein Refugium für die Artenvielfalt.
Hunderte Kilometer Deiche schützen die fruchtbaren Flussmarschen von Elbe und Oste verlässlich vor den immer wiederkehrenden Sturmfluten. Der aufmerksame Besucher wird im Alten Land, in Kehdingen und in der Ostemarsch jedoch eine Vielzahl von Stillgewässern entdecken: mal klein und kreisrund oder auch von beeindruckender Größe. Sie zeugen vom ewigen Ringen des Menschen gegen die Gewalt der Wassermassen – und von seinem Scheitern in historischer Zeit.
Es handelt sich um sogenannte Bracks oder Kolke, die durch die enorme Kraft des durch den Deich brechenden Wassers entstanden sind. In den vergangenen Jahrhunderten waren die Schutzwälle aufgrund ihrer Konstruktion und der nicht immer ausreichenden Unterhaltung bei starken Sturmfluten sehr anfällig und brachen dementsprechend häufig. Wenn das Wasser zurückgegangen war und die Deiche meist notdürftig instand gesetzt waren, blieben neben den vernichteten Existenzen die bodenlosen Bracks zurück. Mit den damaligen Mitteln konnte man diese tiefen Ausspülungen oft nicht wieder verfüllen, daher wurden die neu zu errichtenden Deiche dann halbkreisförmig um die entstandenen Gewässer herumgeführt. Auch wenn die Grundfläche der Bracks vielfach relativ klein ist, erreichen sie beachtliche Tiefen von bis zu 26 Metern – und nicht zuletzt dadurch haben sich viele dieser Sturmflutzeugen bis heute erhalten.
Lebensraum Brack
Diese Kolke sind vielfach als Kulturdenkmale und Naturschutzgebiete geschützt, da sie zum einen interessante Relikte der Deich- und Sturmflutgeschichte darstellen und zum anderen sich zu wertvollen Biotopen entwickelt haben. Im Landkreis Stade erkannte bereits im Jahr 1932 der damalige Pfleger für Naturdenkmäler des Kreises Jork, Hans Peter Siemens, das ökologische Potential der Bracks. In seinem Manuskript „Die Deichkolke des Kreises Jork als Naturdenkmäler“ vereinigte und beschrieb er alle Altländer Relikte: „Ein Stück Natur bedeuten die Deichkolke und ihre Ufer auch für die Pflanzen- und Tierwelt des Wassers und des Sumpfes, und zwar die einzige Stelle innerhalb der Marsch, wo Lebewesen beiderlei Art, unbeeinflusst oder wenigstens fast ungestört vom Menschen, sich entwickeln können.“
Das größte Brack (Wasserfläche von mehr als 6 Hektar) des Alten Landes ist heute Teil des 1985 ausgewiesenen Naturschutzgebietes „Borsteler Binnenelbe und Großes Brack”, mit dem insbesondere die Röhrichtbestände, der naturnahe Weidenauwald und die darin lebende Vogelwelt geschützt werden sollen. Dieses Brack gehört im Alten Land zu den bedeutsamsten Gebieten für den Biotop- und Artenschutz, den Feuchtbiotopverbund und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Zu den besonderen hier lebenden Arten zählen Seeadler, Löffelente, Wasserfledermaus, Finte und auch der Fischotter.
Historie
Gerade das Große Brack hat eine wechselvolle Geschichte erlebt. In diesem Bereich war der Deich immer wieder schweren Prüfungen ausgesetzt. Bereits während der Cäcilienflut des Jahres 1412 kam es hier zu großen Landverlusten. Zahlreiche weitere Deichbrüche sind für das 17. und 18. Jahrhundert überliefert, bis es hier in der Markusflut am 7. Oktober 1756 abermals zu einer verheerenden Flutkatastrophe kam, bei der das jetzige Große Brack entstanden ist. Nur durch den Einsatz von 500 Arbeitern gelang es nach zwei Jahren, die gefährliche Deichlücke endgültig zu schließen. In der zu Hamburg gehörenden dritte Meile ist mit dem Gutsbrack bei Francop ein Kolk als Naturdenkmal geschützt. Es entstand bei der Petriflut am 22. Februar 1651 und wurde bei der Markusflut nochmals tief ausgespült.
Auch in Nordkehdingen prägen zahlreiche Bracks die Kulturlandschaft und erzählen von der wechselvollen Geschichte der Marschbewohner. Die größte Wasserfläche entstand während der verheerenden Weihnachtsflut am 24./25. Dezember 1717 bei Wischhafen. Hier hatte der „Blanke Hans“ den Deich auf großer Länge weggerissen. Die Wasserströme konnten ungehindert ins Hinterland vordringen und das heute noch fast 4 Hektar große Brack auskolken. Nur durch den erheblichen Einsatz von Menschen und Geldmitteln gelang es erst 25 Jahre später, wieder eine geschlossene Deichlinie herzustellen.
Noch weiter im Norden, bei Krummendeich und Balje, ziehen sich kreisrunde Bracks zum Teil perlschnurartig an den historischen Deichlinien entlang. Der 2014 neu erstellte Landschaftsrahmenplan des Landkreises Stade würdigt insgesamt 40 Bracks als „besondere Kleinstgebiete mit besonderer Bedeutung für den Biotopschutz“ und schlägt zahlreiche Gewässer zur Ausweisung als Naturdenkmale vor. Da die Kolke außerdem wichtige Geschichtszeugnisse darstellen, werden sie bei den Denkmalbehörden auch als Bodendenkmale geführt.
Perlschnurartig aufgereihte Bracks in Balje Süderdeich
(Foto: P. Paulsen)
Brack am Elbdeich bei Grünendeich
(Foto: M. Elsen)
Das Große Brack bei Borstel – ehemals immer wieder Deichbruchstelle, heute Teil eines Naturschutzgebietes
(Foto: M. Elsen)
Als Freibad genutztes Brack in Krummendeich (Foto: D. Nösler)

Der Autor
Daniel Nösler
Kreisarchäologe des
Landkreises Stade.
Vom 28. April bis 28. August 2017 wird im Museum Altes Land eine Ausstellung zum Thema „Bracks als Natur- und Kulturdenkmale“ zu sehen sein. Darin wird die Geschichte, Verbreitung und heutige Bedeutung der Kolke in den drei „Meilen“ des Alten Landes gezeigt. Das Buch von Hans Peter Siemens wird in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung zu dem Termin neu erscheinen.



