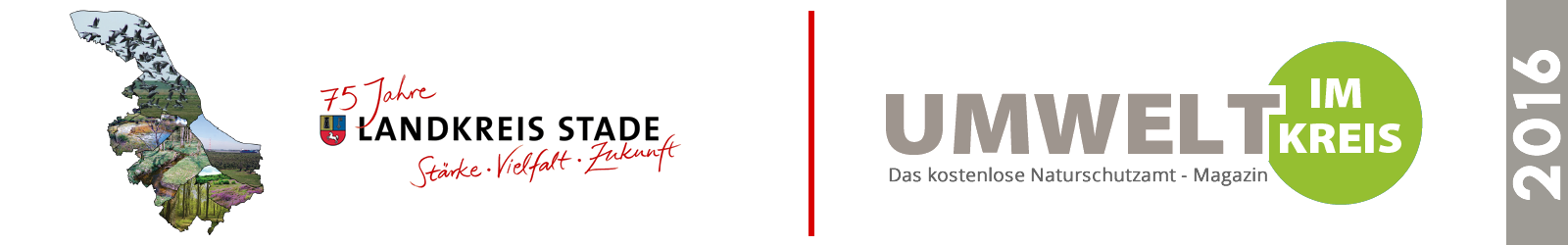
Naturschutz mit den Menschen
Uwe Seggermann leitete 38 Jahre lang das Naturschutzamt
Am 31. März dieses Jahres ist Uwe Seggermann (65) als Amtsleiter des Naturschutzamtes im Landkreis Stade
ausgeschieden und in den Ruhestand gegangen. Als der studierte Landespfleger 1978 den Posten in der neu geschaffenen Naturschutzabteilung besetzte, leistete er Pionierarbeit. Seine Philosophie „Naturschutz funktioniert nur langfristig mit den Menschen“ hat ihn veranlasst, Bürger, Politiker und Landwirte bei Projekten mit ins Boot zu holen. Seine Vorgabe, sich in die Lage der von Regelungen Betroffenen zu versetzen und nach Lösungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu suchen, galt auch für seine Mitarbeiter. 38 Jahre lang hat Uwe Seggermann sich für den Naturschutz stark gemacht und blickt insgesamt zufrieden auf sein Naturschutzengagement zurück. Als Geschäftsführer des von ihm gegründeten Vereins zur Förderung von Naturerlebnissen bleibt er weiter aktiv.
Interview mit Uwe Seggermann
"Wie sind Sie zum Naturschutz gekommen?"
Seggermann: Als Kind haben insbesondere meine Mutter und ich häufig Wanderungen in der Natur unternommen, oft am Meer oder in den Bergen. Dabei hat mich die Tier- und Pflanzenwelt besonders fasziniert: Wie entwickeln sich aus Froschlaich Frösche oder warum werfen Eidechsen bei Gefahr ihren Schwanz ab, der wieder nachwächst.
Vom ersten Berufswunsch, Förster zu werden, habe ich mich dann zu einem Studium der Landespflege umentschieden. Schon nach kurzer Zeit stand für mich fest, dass Naturschutz den Schwerpunkt des Studiums bilden sollte.
Nach zwei Jahren Naturschutzarbeit in Bayern bei der Bezirksregierung Oberfranken konnte ich am 1. Oktober 1978 die Stelle beim Landkreis Stade antreten. Zuerst war der Naturschutz im Planungsamt angesiedelt, dann im Tiefbauamt, danach im Umweltamt und seit 2000 gibt es ein eigenständiges Naturschutzamt.
Als untere Naturschutzbehörde stand mir damals ein Verwaltungsfachmann zur Seite. Der Aufgabenschwerpunkt in den ersten Jahren war, eine Grundakzeptanz für Naturschutzbelange zu finden – insbesondere bei Politikern und Behördenvertretern. Auch damals war man schon „für“ Naturschutz. Allerdings nur solange, bis eigene Interessen kaum davon betroffen waren. Diese Einstellung hat sich bis heute nicht wesentlich geändert. Neue Gesetzeslagen und EU- Bestimmungen stärkten die Stellung des Naturschutzes und erforderten mehr Personal. Zurzeit gehören 14 Personen zum Naturschutzamt, drei davon sind ausschließlich im Außendienst tätig. Immerhin – über die Jahre gerechnet ein Zuwachs von 0,3 Stellen pro Jahr.
"Welche Naturschutzprojekte liegen Ihnen besonders am Herzen?"
Seggermann: Es gibt so viele Projekte, die in den 38 Jahren mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgesetzt worden sind, dass ich keine Rangfolge benennen kann. Es seien hier nur einige genannt:
➜ Ankauf von ca. 1.200 ha Flächen zur Sicherung und Entwicklung von besonders wertvollen Gebieten, davon im Hohen Moor etwa 360 ha.
➜ Vernässung von Mooren (Hohes Moor, Feerner Moor, Oederquarter Moor)
➜ Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit durch die Einstellung einer Fachkraft und die Herausgabe des Naturschutzmagazins „Umwelt im Kreis“
➜ Einrichtung einer vorläufigen Naturschutzstation in Nordkehdingen (jetzt Naturschutzstation des Landes)
➜ Von 2000 bis 2014 jährliche Naturschutzwanderungen mit den Kreispolitikern zu speziellen Naturschutzthemen
➜ Einrichtung des Naturschutzfonds zwecks Umsetzung von Maßnahmen mit Ersatzgeldern
➜ Wiesenvogelschutz in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft
"Worin sehen Sie die größten Probleme?"
Der dramatische Rückgang der Artenvielfalt in unserer intensiv genutzten Landschaft ist erschreckend. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung ist es auch die Flächenversiegelung durch Baumaßnahmen, die zum Artenrückgang führen. Die früher häufigen Arten, wie Kiebitz, Feldlerche oder das Rebhuhn, sind schon fast verschwunden.
Dieser Artenschwund lässt sich auch nicht wesentlich mit Schutzgebietsausweisungen aufhalten, da notwendige Regelungen der Bewirtschaftung politisch nicht durchsetzbar sind. Ich habe die Hoffnung, dass über die Flächenbezuschussung der EU – die jeder Landwirt aus unseren Steuermitteln erhält – zukünftig Regelungen eingeführt werden. Beispielsweise sollten auf mindestens 5% des jeweiligen Ackerstandortes Blüh- oder Ruderalstreifen angelegt werden. Leider ist dies in der jetzigen Förderperiode – obwohl es vorgesehen war – nicht umgesetzt worden.
"Was sind Ihre Wünsche für den Naturschutz?"
Ich würde mich freuen, wenn die vielen Angebote, die heimische Natur kennenzulernen, von noch mehr Menschen genutzt werden. In der Hoffnung, dass dadurch die Erkenntnis wächst, behutsamer mit unser heimatlichen Natur umzugehen.
Durch mein Insiderwissen bin ich in der glücklichen Lage, meinen vier Enkelkindern noch die naturnahen Flächen im Landkreis zu zeigen. Denn ich würde mir wünschen, dass bei der Einschulung jedes Kind einen Kiebitz vom Weißstorch, einen Spatz von einer Meise und eine Eiche von einer Buche unterscheiden kann.
Das Interview führte Janette Hagedoorn- Schüch (Foto: C.C. Schmidt).
